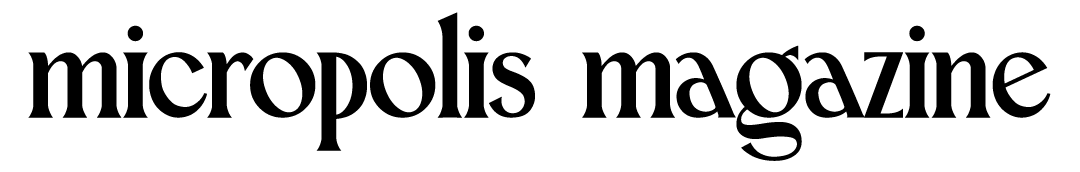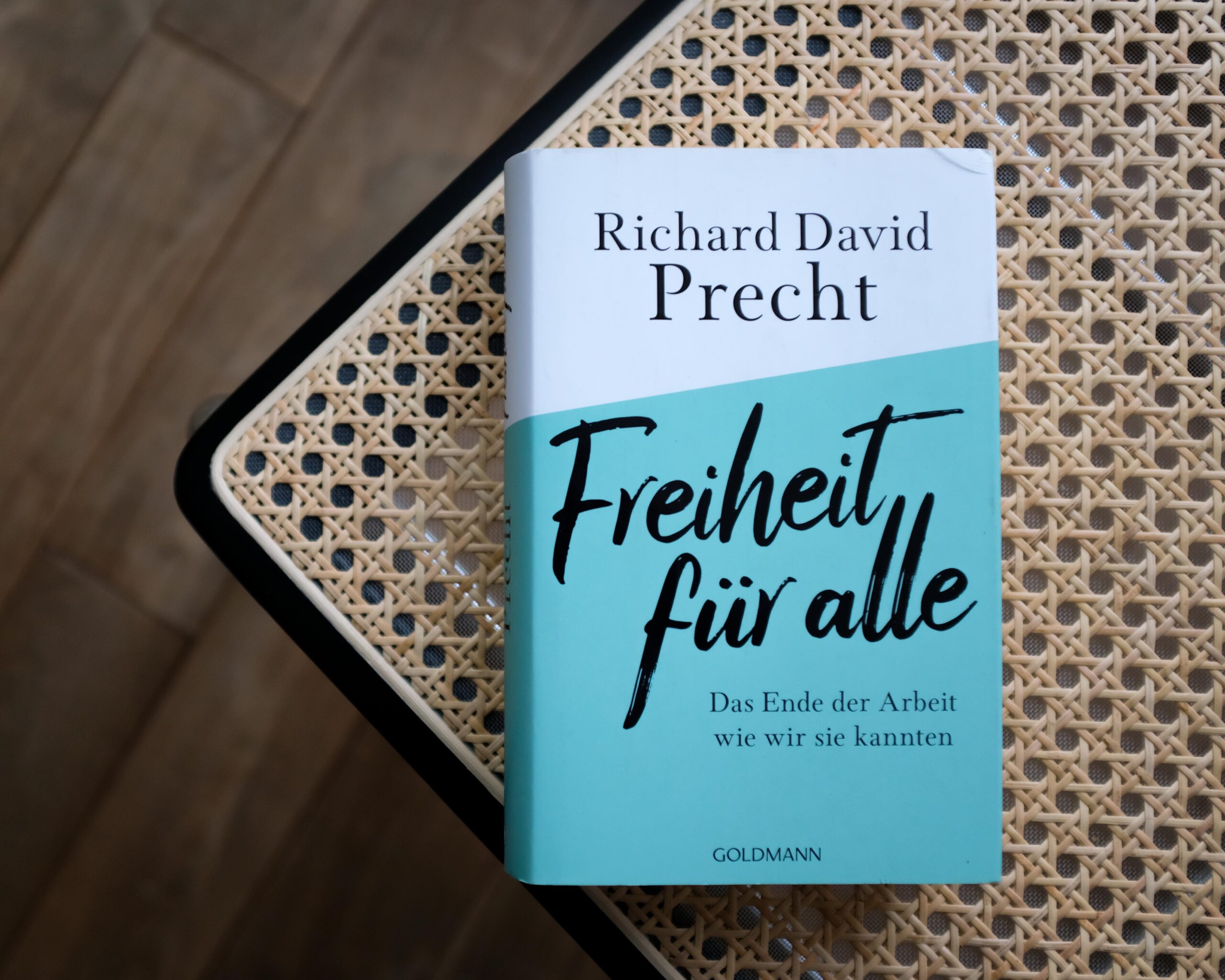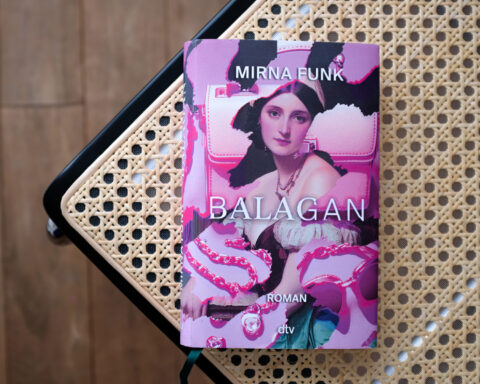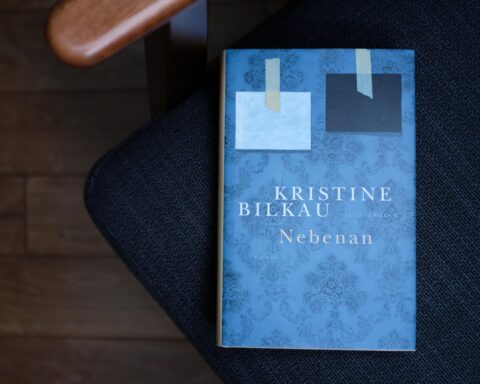Arbeit verändert sich und mit ihr das Selbstverständnis jener, die von Ideen leben. Was lange als Kern kreativer Berufe galt, wird heute zunehmend von Maschinen übernommen. Künstliche Intelligenz liefert in Sekunden, wofür wir früher Stunden brauchten und der technologische Wandel wirft die Frage auf: Wie steht es um die Zukunft kreativer Arbeit?
Ich schreibe diesen Text im Wissen, dass ChatGPT mir diese Aufgabe abnehmen könnte. Es würde in Sekundenschnelle Ideen zusammentragen, eine Struktur vorschlagen, passende Formulierungen liefern und mir zum Schluss einen fertigen Text auswerfen, den ich ohne lange Überarbeitungszeit veröffentlichen könnte. Wäre ich damit zufrieden? Wer weiß… . Wäre die Arbeit erledigt? Keine Frage.
Schon dieses kleine Beispiel zeigt: Die Zeichen stehen auf Umbruch. Doch eigentlich beginnt kreative Arbeit dort, wo Algorithmen enden. Denn Geschichten so zu erzählen, dass sie berühren. Widersprüche auszuhalten, statt sie glattzubügeln und eine Haltung zu formulieren, die nicht ohne weiteres austauschbar ist – bei diesen Aufgaben stößt KI an ihre Grenzen. Originalität ist weiterhin Trumpf.
New Work? New Life!
Auch die Rahmenbedingungen des Arbeitens verändern sich rasant. Remote und Hybrid sind längst keine Ausnahmen mehr, global verteilte Teams kommunizieren dank Slack und Miro über Kontinente und Zeitzonen hinweg. Das gibt Freiheit, verlangt aber gleichzeitig Disziplin und bedeutet: Wer kreativ arbeitet, braucht nicht nur die richtige Software, sondern Motivation und Managementqualitäten. Berufliche und persönliche Entwicklung wird dabei zum Dauerzustand.
Im Sinnieren über die Zukunft des Arbeites drängt sich ein Gedanke auf, den Richard David Precht in seinem Buch Freiheit für alle aufgreift. Er fragt, was passiert, wenn Arbeit, wie wir sie kannten, schlicht nicht mehr gebraucht wird. Wenn nicht nur Texter:innen, Designer:innen oder Journalist:innen, sondern ganze Branchen automatisiert werden. Seine Antwort: Wir sollten die enge Bindung zwischen Erwerbsarbeit und Einkommen auflösen – und über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken.
Ob man diesem Vorschlag zustimmt oder nicht: Precht öffnet einen Resonanzraum. Er zeigt, dass die Debatte über KI und Arbeit größer ist als die Frage, welche Software uns gerade ersetzen oder unterstützen könnte. Ihm geht es um Freiheit und um die Chance, Zeit für das zu haben, was Sinn stiftet. Gerade das ist für Kreativschaffende oft die größte Motivation der eigenen Arbeit, wie eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) und der Stiftung Kunstfonds in Berlin zeigt.
Precht verschränkt Debatten um Technologie, Gerechtigkeit und Selbstverwirklichung miteinander und gibt Impulse, die zum selber denken herausfordern. Was wir aus der Lektüre und der aktuellen Entwicklung machen, wie sie weiter denken und für uns adaptieren, ist in unserer Verantwortung. Denn genau darin liegt die eigentliche Arbeit, die jetzt beginnt.