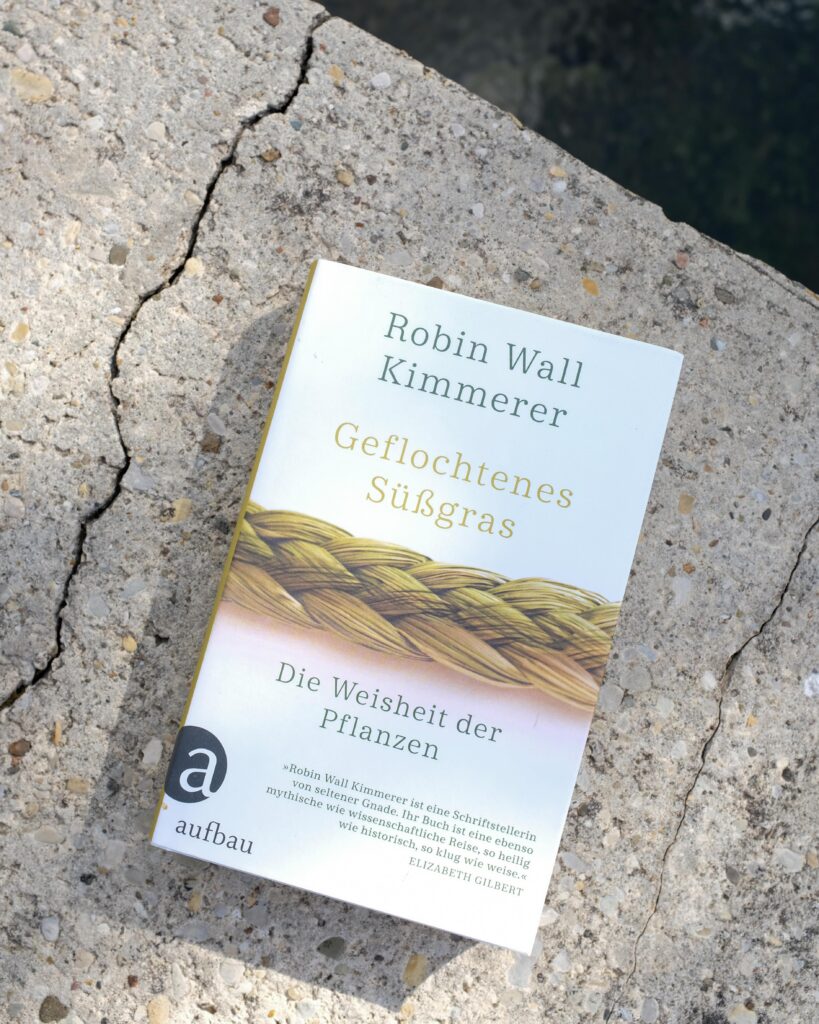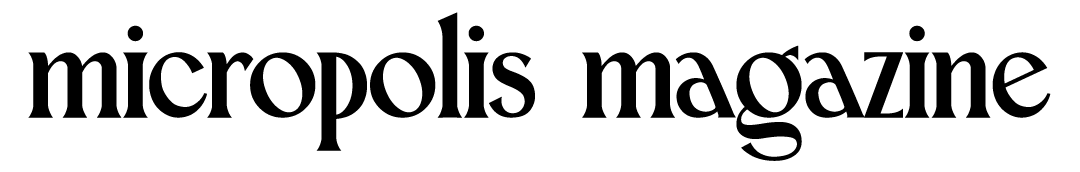Kunst. Stadt. Zukunft?
Was ich mit Natur verbinde, verändert sich mit den Erlebnissen, die ich mit ihr mache. Ist ein Fluss etwas, das mir Ruhe und Kraft spendet? Das mich schützt und nährt? Oder etwas, vor dem ich mich fürchte? Das mein Leben bedroht, weil er sich von einem Moment auf den anderen in einen reißenden Strom verwandeln kann?
Als ich den ersten Blick auf die Ausstellung Der Fluss bin ich werfen darf, zeigt das Thermometer bereits am frühen Morgen über zwanzig Grad an. Ich treffe Marijke Lukowicz im Rosengarten von Schloss Neuhaus am Rande der Stadt Paderborn. Vor knapp zwei Jahren hat sie die Position der Künstlerischen Leitung der lokalen Ausstellungsreihe übernommen. In zwei Wochen wird es endlich losgehen.
Ich bekomme eine Preview – einen ersten Rundgang mit ihr entlang des Flusses, an dem die Künstler*innen ihre Werke verortet haben. Eine Anordnung, die alles andere als zufällig ist. Denn die Lebensader, die durch die Stadt fließt, bildet das verbindende Thema der künstlerischen Arbeiten.

Wie kann Kunst Stadtentwicklung beeinflussen?
Um das Zusammenwirken von Kunst und Stadt besser zu verstehen, habe ich im Frühjahr einen Blick auf die diesjährige Architekturbiennale in Venedig geworfen. Unter dem Titel Intelligens. Natural. Artificial. Collective. lockt die Veranstaltung vom 10.05.2025 bis zum 23.11.2025 Kunst- und Designinteressierte in die Lagunenstadt. Kuratiert von Carlo Ratti, einem Architekten und Ingenieur, der am Massachusetts Institute of Technology (MIT) sowie am Politecnico di Milano forscht und lehrt, setzt sich die Ausstellung mit ökologischen, technologischen und sozialen Umbrüchen der Gegenwart auseinander – und sucht nach Antworten in der Architektur.
Im Zentrum steht die Frage nach möglichen Lösungen für die Herausforderungen der Klimakrise. Nachdem die Erde im Jahr 2024 die höchsten jemals gemessenen Temperaturen verzeichnete und die globalen Durchschnittswerte das 1,5-°C-Ziel des Pariser Abkommens erstmals überschritten, geht es nicht mehr nur darum, die menschlichen Einflüsse auf die ökologische Bedrohung zu verringern, sondern auch darum, den mittlerweile sichtbaren Veränderungen unserer Umwelt angemessen zu begegnen.
Gerade das (Über-)Leben in der Stadt ist dabei ein zentrales Thema. Mit mehr als 300 Beiträgen, eingereicht von über 750 Teilnehmer:innen aus unterschiedlichen Fachgebieten, bietet die Biennale ein breites Spektrum an Perspektiven. Wie viele aktuelle Denkbewegungen richtet auch sie den Blick auf den menschlichen Intelligenzbegriff und seine Erweiterung. Über traditionelle Kategorien hinaus geht es daher um natürliche, künstliche und kollektive Intelligenzen, die die Suche nach neuen Formen von Wissen und Gestalten bereichern sollen.
Das Thema „Künstliche Intelligenz“ betrachtet unter anderem das Werk Calculating Empires: A genealogy of technology and power since 1500 von Kate Crawford und Vladan Joler. Die Arbeit veranschaulicht, wie sich technische und soziale Strukturen über fünf Jahrhunderte hinweg gemeinsam entwickelt haben und zeichnet die technologischen Muster von Kolonialismus, Militarisierung, Automatisierung und Einfriedung seit 1500 nach. Die Künstler:innen geben mit dem Werk eine komplexe aber wirkmächtige Hilfestellung, unsere technologische Gegenwart und ihre Verflechtungen besser zu verstehen. Neben der physischen Version, von der ein Teil ebenfalls im Ars Electronica Center in Linz sowie an vielen anderen Orten auf der ganzen Welt ausgestellt ist, stellen Crawford und ihr Team aus Forschenden die Karte ebenfalls online zur Verfügung, wo sie vollständig und kostenlos zugänglich ist.
Viele der Länderpavillons der Architekturbiennale beschäftigen sich in diesem Jahr mit dem Thema Überhitzung. Auch der deutsche Pavillon reiht sich in diesen thematischen Schwerpunkt ein. Hinter dem dort präsentierten Stresstest stehen Nicola Borgmann, Elisabeth Enders, Gabriele G. Kiefer und Daniele Santucci. Ihr Projekt soll ein Bewusstsein für die Dringlichkeit einer menschlichen Verhaltensänderung schaffen, indem es Besucher:innen mithilfe von Wärmestrahlern und Wärmebildkameras erfahrbar macht, wie starke Hitze auf den Körper wirkt. Es erinnert mich an eines der Großprojekte des dänisch-isländischen Künstlers Olafur Eliasson: 2003 bespielte er die Turbinenhalle der Londoner Tate mit einer künstlichen Sonne unter dem Titel The Weather Project. Zwar wurde die Temperatur der Halle nicht verändert, doch auch dieser Besuch war zweifellos ein Erlebnis mit politischer Botschaft.
Spannend ist, dass durch die Biennale eine der wohl am stärksten vom Klimawandel bedrohten Städte der Welt zugleich zur Kulisse und zum Versuchslabor seiner Bewältigung wird. Doch neben der Suche nach Lösungen regt die Veranstaltung auch dazu an, anders zu denken – etwa durch die Verleihung des Goldenen Löwen, mit dem in diesem Jahr die amerikanische Philosophin Donna Haraway für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde.


Im Fluss
Auch die Paderborner Ausstellung Der Fluss bin ich orientiert sich an Grundgedanken, die sich in den Arbeiten von Donna Haraway finden. Ausgangspunkt der Veranstaltung war der Wunsch nach einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem innerstädtischen Quellgebiet und dem zugehörigen Flusslauf der Pader. Bereits der Titel deutet darauf hin, wie die Lebensader der Stadt den öffentlichen Raum formt – und umgekehrt von den Stadtbewohner:innen geformt wird. Unter der Leitung von Marijke Lukowicz und Sophia Trollmann ist die Gruppenausstellung Teil einer ortsspezifischen Reihe zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum, die 2007 initiiert wurde und nun – vom 28.06.2025 bis 05.10.2025 – zum dritten Mal stattfindet.
„Seit der letzten Ausstellung sind mittlerweile zehn Jahre vergangen. Neben der künstlerischen Forschung als Disziplin ist seitdem auch die kuratorische Forschung entstanden“, erzählt mir Marijke Lukowicz während unseres Spaziergangs. „Ihren Grundideen entsprechend haben wir uns vor der Auswahl der Künstler:innen zuerst sehr intensiv mit der Stadt, ihren Akteur:innen und der Gegend rund um den Fluss auseinandergesetzt.“ Einer ihrer Leitgedanken war dabei, im Sinne Haraways eine Verbindung zwischen Mensch und Natur aufzubauen. Viele der ko-kreativ entstandenen Arbeiten sind daher eine Einladung, sich als Menschen mit natürlichen wie auch künstlich angelegten Welten verbunden zu erleben.
Be Water
Beim Spaziergang mit Marijke entlang der Pader wird mir bewusst, wie gut sich der Blick auf den Fluss eignet, um die Verbundenheit zwischen Mensch und Natur sichtbar zu machen. „Die Pader ist ein urbaner Naturraum, der künstlich geschaffen wurde. Dass der Mensch bereits hier eingegriffen hat, ist vielen wahrscheinlich gar nicht mehr bewusst. Der Fluss wurde nach einem sehr klassischen Bild von Landschaft renaturiert – eine Anlehnung an romantische Landschaftsdarstellungen in der Kunst, die im westlichen kollektiven Gedächtnis verankert sind“, erläutert Marijke. Genau für diese Arten von Wissen und Miteinander Aufmerksamkeit zu schaffen, hat die Kurator:innen gereizt.

Doch es ist mehr als die Anlehnung an Sehgewohnheiten, die Flüsse zu so angenehmen und wichtigen Orten für uns Menschen macht. Als Lebewesen aus dem Wasser hervorgegangen, sind wir noch heute auf das Zusammenwirken mit dem Element angewiesen: Unser Körper besteht zu etwa zwei Dritteln aus Wasser. Flüsse sind seit jeher Trink- und Nahrungsquellen für uns und sichern beispielsweise als Transportwege menschliches Überleben und Wohlstand. Ähnlich wie ein Spaziergang durch den Wald verringert auch der Blick auf Wasser – ebenso wie das Geräusch eines Flusses – unser Empfinden von Stress und lädt uns zum Tagträumen und Reflektieren ein. Spiegelungen, Bewegungen und Lichtspiele auf der Wasseroberfläche stimulieren unsere Sinne, ohne sie zu überfordern. Seine umschließende Eigenschaft macht das Element zudem zu etwas, das Wohlgefühl und Geborgenheit entstehen lässt und dem Gefühl des Getrenntseins entgegenwirkt.
Trotzdem uns so viel mit dem Fluss verbindet, nehmen wir uns in der Regel als von ihm separiert wahr – eine Distanz, die nicht selten auch unser Handeln prägt. Diese Wahrnehmung ist kein Zufall. Dr. Daniela Zyman, Autorin, Forscherin sowie Chefkuratorin und Künstlerische Leiterin von Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21), beschreibt sie als Folge eines anthropozentrisch geprägten Weltbildes, das über lange Zeit ausbeuterische Verhältnisse und Formen der Bewirtschaftung hervorgebracht hat. In einem Beitrag zur Ausstellung formuliert sie es so: „Wasser, anders als Luft, ist ein sensorisch erfassbares Medium der Beziehung.“ In mehreren Arbeiten der Paderborner Ausstellungsreihe wird diese Einsicht sinnlich erfahrbar.
Das Recht zu Fließen
Die Beziehung zu sich selbst thematisiert unter anderem die Künstlerin Sophie Utikal in ihren Arbeiten zu Pause und Erholung – zwei gesellschaftlich immer bedeutsameren Themen, die sie poetisch, sinnlich und zugleich sehr zugänglich durch figurative Darstellungen adressiert. „Der Bezug zwischen Wasser und Arbeit ist ebenso eng wie seine Verbindung zu Ruhe und Entspannung“, erläutert Marijke Lukowicz. „Bereits prähistorische Siedlungen befanden sich in der Regel an Flussläufen. Sie waren einer der Gründe, warum Menschen damit begannen, über Arbeit ihren Tag zu strukturieren. Dabei ging es unter anderem um Zugang, Transport und Handel.“ Auch in Paderborn war der Fluss ein Ort der Arbeit. Die ihn umgebenden Wiesen dienten beispielsweise dem Anbau von Flachs, der zur Herstellung von Leinen genutzt wurde.

Ein weiteres Thema ist der Blick auf den Fluss nicht nur als Landschaftselement, sondern als handlungsfähigen Akteur und Teil der Stadtgesellschaft. Die Künstlerin Anne Duk Hee Jordan formuliert dafür einen Vertrag zwischen der Pader und den Bewohner:innen der Stadt. Damit wird der Fluss selbst zum juristischen Subjekt, das Rechte beanspruchen und Pflichten einfordern kann. Besucher:innen der Ausstellung sollen sich so ihrer persönlichen Verantwortung gegenüber der Mitwelt bewusst werden. Jordans künstlerisches Experiment eröffnet damit nicht nur einen politischen, sondern auch einen philosophischen Raum: Die Pader tritt – im Sinne Hannah Arendts – als Subjekt auf, das Teil des gesellschaftlichen Handelns ist.
The other side
Kurz nachdem ich vom Spaziergang mit Marijke in meine Wohnung zurückkehre, beginnt es zu regnen. Es ist kein gewöhnlicher Schauer am Ende eines warmen Sommertages, kein leichter Regen, der die Stadt unter einem leuchtenden Regenbogen zurücklässt. Stattdessen folgen Blitz und Donner in kaum wahrnehmbaren Abständen. Hagel und daumengroße Regentropfen prasseln, vom Sturm gepeitscht, gegen die Dachfenster meiner Wohnung. Es ist der lärmende Abschluss eines viel zu heißen Tages – ein Zustand, der nicht einfach als Wetter über die Stadt hinwegzieht, sondern sie verwüstet zurücklässt.
Als der Sturm an Kraft verliert und die durchsichtiger werdende Regenwand den Blick von meinem Balkon wieder freigibt, sind die Straßen überschwemmt. Kanaldeckel wurden vom Wasser hochgedrückt, Unterführungen überflutet, und die wenigen verbliebenen Autos schieben Wellen über den Asphalt, die an den Bordsteinen brechen. Erst drei Jahre ist es her, dass ein Tornado über Paderborn zog. Damals blickte ich aus demselben Fenster. Dachte dieselben Gedanken. Was können wir tun?
Solution Thinking
Am 18. August 2024 ist die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur in Kraft getreten. Darin ist die Forderung enthalten, dass alle EU-Mitgliedsstaaten bis Anfang 2026 einen Entwurf für einen Plan zur Wiederherstellung der nationalen Ökosysteme entwickeln müssen1 – die finalen Versionen sollen im September 2027 vorliegen. Die EU reagiert hiermit unter anderem auf die Warnung der Europäischen Umweltagentur, die den Kontinent als nicht ausreichend auf die bevorstehenden Auswirkungen des Klimawandels vorbereitet sieht.2 Insbesondere die gesellschaftliche Vorsorge wird darin als unzureichend herausgestellt, „[…] da die Maßnahmen angesichts des rapiden Anstiegs des Risikoniveaus zu langsam umgesetzt werden.“3
Einer jährlichen Umfrage der Europäischen Investitionsbank zu Folge, geben 80% von mehr als 24 000 EU-weit befragten Teilnehmer:innen im Jahr 2024 an, in den vergangenen fünf Jahren mindestens einmal Extremwetter erlebt zu haben.4 72% gehen davon aus, dass sie ihre Lebensweise wegen des Klimawandels anpassen müssen, 28% geben an, sie müssen wahrscheinlich in eine kühlere Region ziehen. Auch, wenn diese Zahlen ein hohes Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels bei europäischen Bürger:innen erwarten lassen, geben sie keine Auskunft über ein Umdenken oder eine mögliche Anpassung im Handeln von Zivilgesellschaft, Unternehmertum oder Politik.
Was kann Kunst?
In den letzten Jahren habe ich viele Ausstellungen besucht, die sich mit den Themen Kunst und Klima sowie dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur auseinandersetzen – darunter Survival in the 21st Century in den Deichtorhallen Hamburg und Fellow Travellers. Kunst als Werkzeug, die Welt zu verändern im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass es Kurator:innen und Künstler:innen um mehr geht, als nur Aufmerksamkeit auf das aktuell so zeitgemäße Thema der Klimakrise zu lenken. Über Ausstellungen und Werke können sie unseren Blick lenken, uns zeigen, wie wir als Menschen mit unserer Umgebung interagieren, auf sie einwirken und sie verändern. Genau deshalb braucht eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Klimawandel mehr als Bestandsaufnahmen, Anregungen oder Ideen zur Schadensbewältigung. Sie braucht Kunst, die Lösungsvorschläge wagt.
Ob literarisch, bildnerisch oder angewandt – künstlerische Bewegungen haben die Kraft, ästhetisch-utopische Gegenentwürfe zu schaffen und mögliche Zukünfte zu imaginieren. Sie können Räume eröffnen, in denen wir mehr-als-menschlichen Wesenheiten begegnen, Erfahrungen machen, die uns fremd sind, und dadurch unsere Perspektive erweitern. Sie können die Grenzen zwischen Illusion und Wirklichkeit verschieben, blinde Flecken in gesellschaftlichen Debatten sichtbar machen und kollektives, transdisziplinäres Handeln inspirieren. Ganz ähnlich beschreibt es auch Marijke Lukowicz: „Eine Methode, die uns im Vermittlungskonzept zur Ausstellung besonders wichtig war, ist das Unlearning. Wir meinen damit das Hinterfragen, das Andersdenken sowie die Kraft der Imagination. Es geht uns darum, bestehende Strukturen zu erweitern und Lösungen zu entwickeln, Wissen zu generieren und ernst zu nehmen – ob direkt aus der Natur oder von den Menschen, die an der Pader leben.“



In den letzten Jahren habe ich mehrfach erfahren, welche Spuren katastrophale Naturereignisse in einer Stadt, aber auch im eigenen Gedächtnis hinterlassen. Doch ich hoffe noch immer, dass es auch andere Wege gibt, die uns verdeutlichen, dass es höchste Zeit ist für Veränderung. Natürlich können künstlerische Auseinandersetzungen diesen wirkmächtigen Einschnitten keine gleichwertige Erfahrung entgegensetzen. Dennoch können sie Veränderungen spürbar machen – wie beispielsweise im deutschen Pavillon der Architekturbiennale in Venedig. Sie können Erfahrungsräume bieten, die uns nicht nur die Folgen unseres Handelns vergegenwärtigen, sondern die uns der mehr-als-menschlichen Welt näher bringen und Empathie und Nähe schaffen für Akteure, von denen wir uns lange so fern schienen. So geschieht es aktuell auch in Helsinki.
Displacing the antropocentric gaze
Die 2025 zum dritten Mal stattfindende Helsinki Biennale hat sich zum Ziel gesetzt, unseren anthropozentrischen Blick herauszufordern und zu verschieben. Unter dem Titel Shelter lotet sie unter anderem auf der ehemals militärisch genutzten Insel Vallisaari Perspektiven aus, die über den Menschen hinausgehen und die Stimmen von Pflanzen, Insekten, Pilzen, Mineralien und anderen nichtmenschlichen Akteur:innen einbeziehen. Dabei versteht sie Kunst als Mittel, positive Handlungen zu inspirieren und das Verständnis für die Komplexität natürlicher Netzwerke zu vertiefen – auch wenn dafür manchmal die Grenzen zwischen Realität und Fiktion überschritten werden müssen.
Gerade solche Ausstellungen, in denen Stimmen aus unterschiedlichen Wissenstraditionen zusammenkommen und miteinander in Dialog treten, sind dringend notwendig. Sie können geistige Grenzen behutsam verschieben und ästhetische Prozesse entfalten, die nicht nur als Spiegel fungieren, sondern auch als Impulsgeber für Wandel und Reflexion. In dicht besiedelten Stadtlandschaften, in denen Tag für Tag Menschen, Tiere, Pflanzen, Infrastrukturen und Mikroorganismen aufeinandertreffen, eröffnen sie Bühnen, um das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt neu zu verhandeln. Künstlerische Forschung kann so nicht nur Diskurse befördern, sondern auch urbane Entwicklung mitgestalten, zivilgesellschaftliche Initiativen anstoßen und Plattformen für Austausch schaffen.


Von besonderer Bedeutung scheint mir dabei, dass Kurator:innen und Künstler:innen – ebenso wie bei der Ausstellung Der Fluss bin ich in Paderborn – die Stadtgesellschaft aktiv in den Konzeptions- und Ausstellungsprozess einbinden, etwa durch Workshops, partizipative Formate, innovative Vermittlungskonzepte und ko-kreative Interventionen. Damit nutzen sie die Räume, die Kunst eröffnet, nicht als abgeschlossene Galerie-Spaces, sondern als lebendige Laboratorien des Ausprobierens und Miteinander-Denkens. Auf diese Weise werden Ausstellungen zu Schnittstellen zwischen Kunst, Natur, Politik und Gemeinschaft, die beweisen, dass ästhetische Interventionen mehr sind als Symbolik. Sie sind Räume des Denkens und Handelns, die deutlich machen, dass Wandel nicht nur in Konzepten stattfindet, sondern vielmehr im Erleben, im Zuhören und in der Begegnung mit dem Fremden, Neuen und Anderen.
Beteiligte Künstler*innen und Quellen

Die stimmungvollen Bilder, die diesen Beitrag rahmen, stammen von Wolfgang Safer. Seit einigen Monaten wandert er mit der Kamera entlang der Pader – aufmerksam, langsam, suchend. Ihn interessieren stille Übergänge zwischen Natur und Stadt, zwischen dem Sichtbaren und dem, was sich nur andeutet. Seine Fotografien entstehen im Moment des Innehaltens – spontan und offen für das Flüchtige. Eine Auswahl seiner Arbeiten wird ab dem 13.11.2025 in der Ausstellung „Komplizen des Glücks“ zu sehen sein.
Buchempfehlungen zum Thema
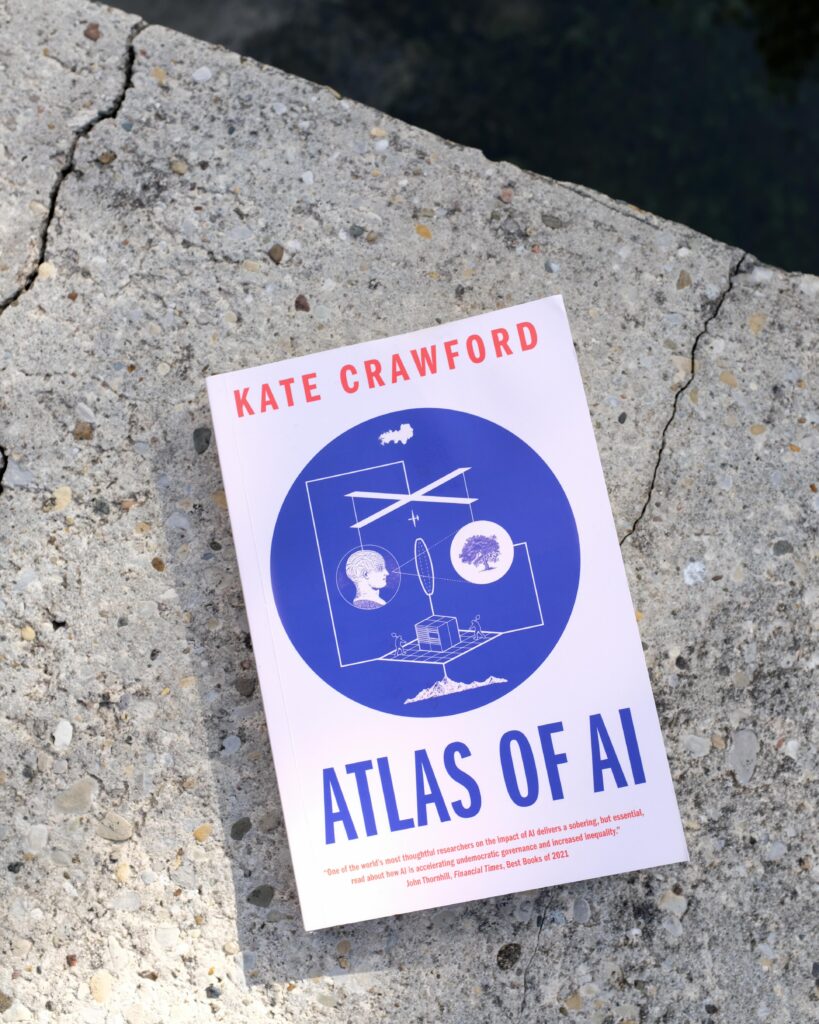
Kate Crawford zeigt in Atlas of AI eindrucksvoll, dass Künstliche Intelligenz nicht nur aus Code und Daten besteht, sondern tief in gesellschaftliche, politische und ökologische Strukturen eingebettet ist. Sie beleuchtet, wie Rohstoffe, Arbeitskraft und Machtinteressen die Entwicklung von KI prägen – und hinterfragt kritisch die Vorstellung von „intelligenten“ Maschinen als neutralen Werkzeugen.
Das Buch ist keine technische Einführung, sondern eine tiefgehende Analyse der sozialen und ethischen Dimensionen von KI. Wer verstehen möchte, welche unsichtbaren Kosten und Machtverschiebungen mit dieser Technologie verbunden sind, findet hier eine kluge, gut recherchierte und anregende Lektüre.
„We are Volcanoes“ von Charlotte Kerner porträtiert die drei außergewöhnlichen Denkerinnen Rachel Carson, Lynn Margulis und Donna Haraway. Jede von ihnen hat auf ihre Weise unser Verständnis von Natur, Wissenschaft und dem Verhältnis von Mensch und Umwelt revolutioniert. Kerner verbindet biographische Elemente mit wissenschaftlichen Ideen und literarisch-fiktionalen Einschüben, wodurch ein lebendiges und inspirierendes Bild entsteht.
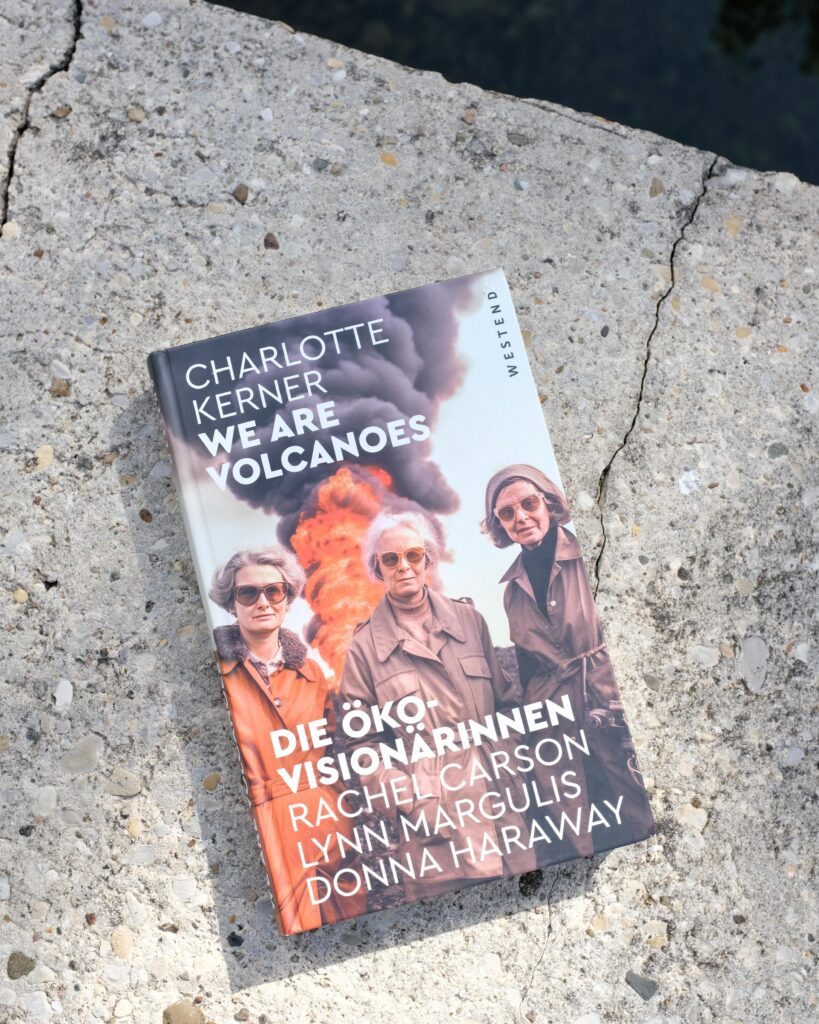
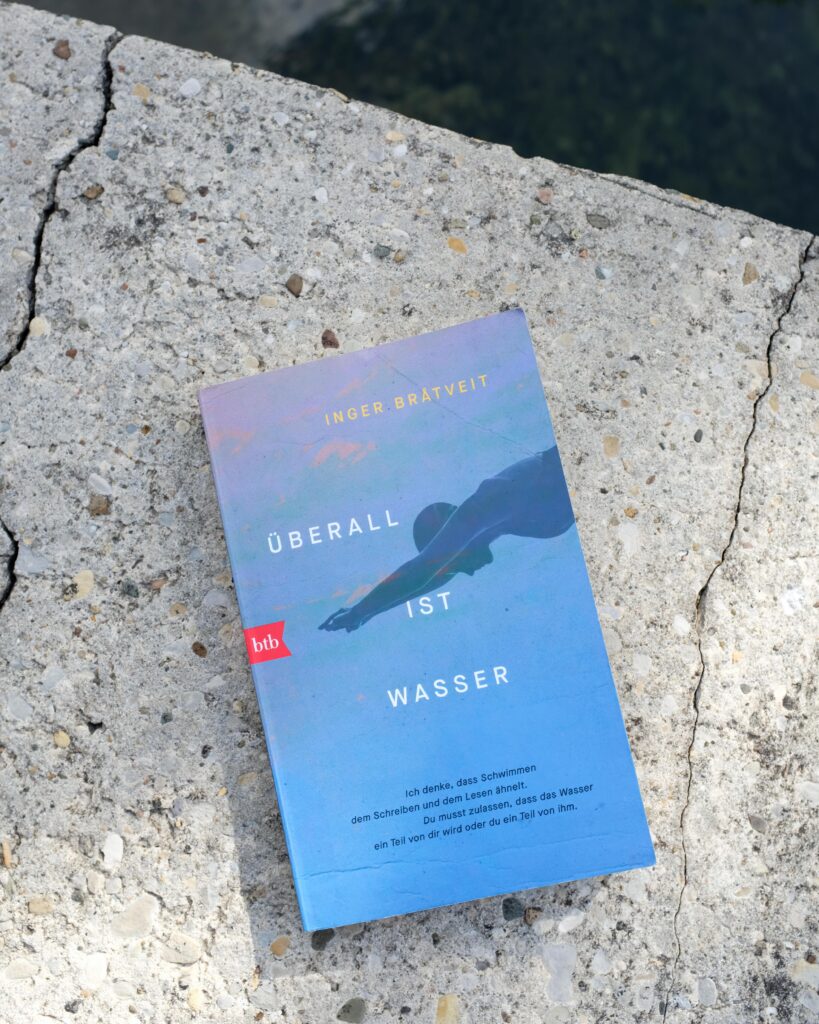
In Überall ist Wasser reflektiert Inger Bråtveit zentrale und unbedeutende Momente ihres Lebens verbunden durch das Motiv des Wassers. Sie verwebt Gedanken und Erfahrungen aus Leben, Kreativität und Elternschaft in poetisch feiner Sprache mit denen literarischer und philosophischer Vorbilder zu einer feinsinnigen Erkundung des ewigen Zusammenspiels von Natur und Selbst.
Geflochtenes Süßgras verbindet indigene Weisheit und botanische Wissenschaft zu einer lebendigen Erzählung über das Verhältnis von Mensch und Natur. Robin Wall Kimmerer, Professorin für Umweltbiologie und Angehörige der Potawatomi, berichtet in einer Sammlung aus Essays von Pflanzen, Mythen und ihrer eigenen Lebensgeschichte. Im Mittelpunkt steht das Süßgras, das von den Potawatomi als heilige Pflanze verehrt wird — als Symbol von Fürsorge, Gabe und Beziehung zwischen der Erde und ihren Bewohner*innen. Kimmerer erklärt, wie traditionelle Praktiken wie die „ehrenhafte Ernte“ nicht nur Respekt zeigen, sondern auch positiv zur Gesundheit der Natur beitragen. Sie lädt ein, die Natur nicht als Ressource, sondern als Verwandte zu sehen, und ein Leben zu gestalten, das auf Geben, Dankbarkeit und gegenseitiger Verantwortung beruht.